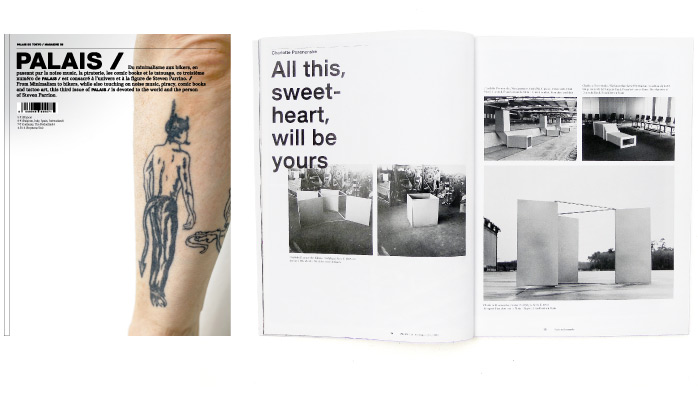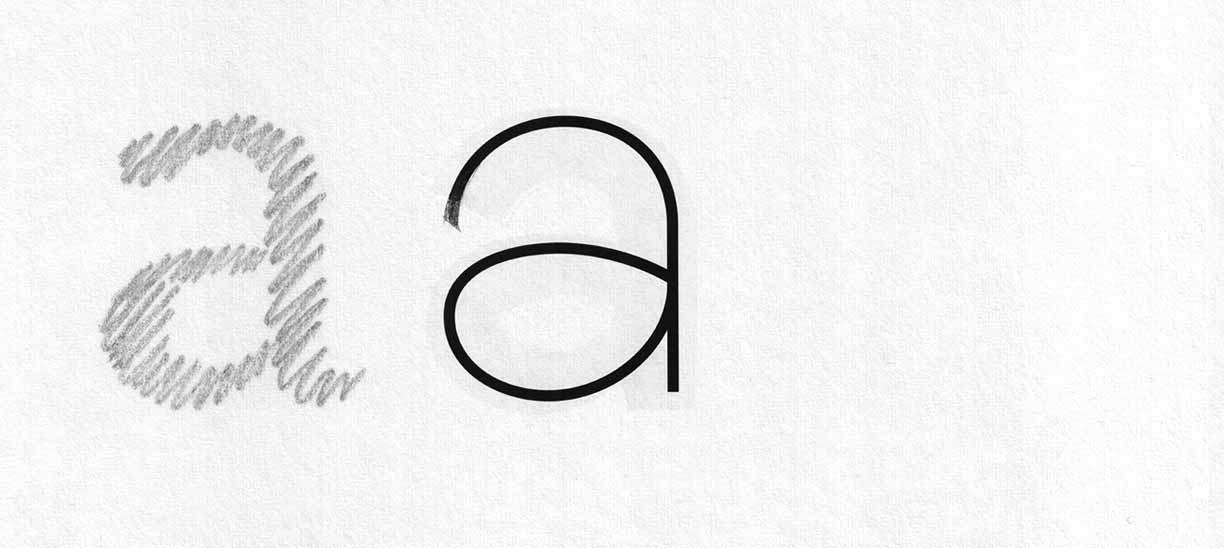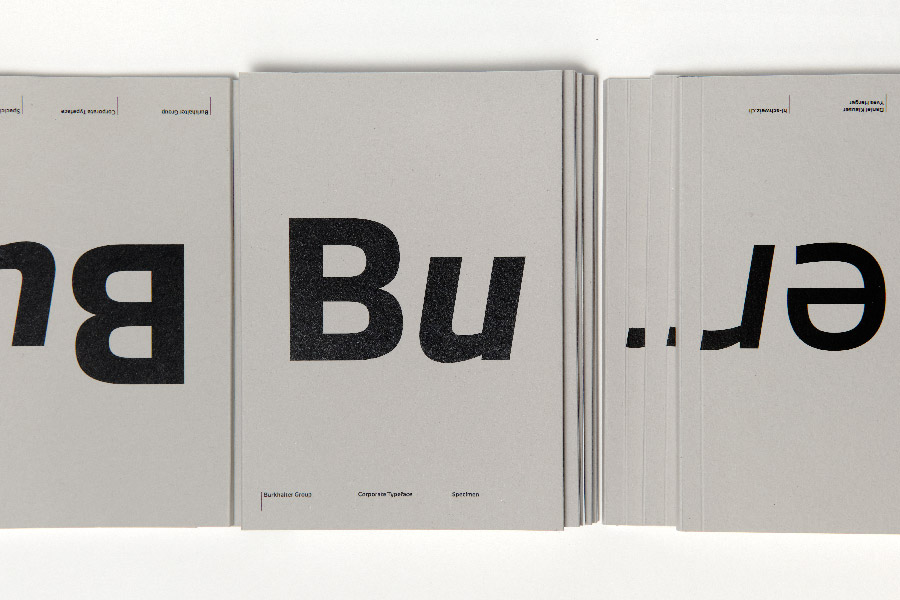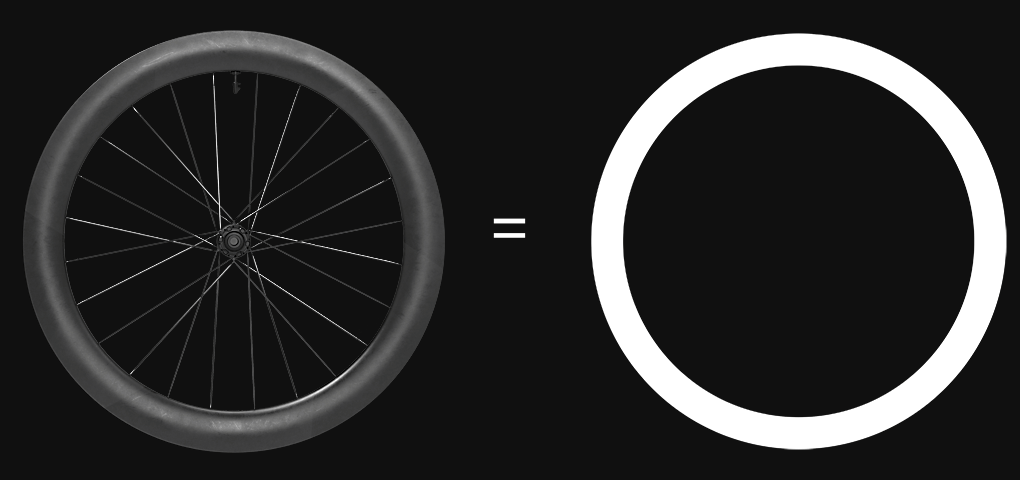Michael Mischler Du hast zwei wunderbare Beispiele genannt! Nivea, gesetzt in der Futura, vielleicht für diesen Zweck leicht abgeändert und der schwungvolle Coca-Cola-Schriftzug von Frank M. Robinson. In unserer Jugend war der Coca-Cola-Schriftzug sehr modern, das Unternehmen erfrischte mit seiner Werbung und seinem Markenauftritt und erschien uns am Puls der Zeit. Aber ist das im Zeitalter von Red Bull und Quinoa für junge Leute heute noch so? Was für uns Coolness bedeutete, wird heute mit einer beschwingten Post-Hippie-Buntheit vermittelt. Dennoch ist es immer möglich, dass eine alte Cola-Dose mit ihrem schmucken Design als Fundstück aus der Brockenstube zur Inspirationsquelle werden kann. Als Typografen sind wir immer auf der Suche nach Inspirationen. So ist es naheliegend, dass auch bekannte und weniger bekannte Markennamen mit ihren Schriftzügen dazu anregen, die Alphabete zu vervollständigen. Es gibt einige Beispiele an Schriften, welche nur wenige Buchstaben in Form eines Schriftzuges als Vorlage hatten: so z.B. die Schriften Brauer von Philippe Desarzens und Elektrosmog, die vom Schriftzug der Brauerei Hürlimann abgeleitet wurden, oder die Tablettenschrift von Reala, die vom PEZ-Schriftzug ausging.
Nik Thoenen Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass bei vielen Marken-Schriftzügen auf bestehende Schriften zurückgegriffen wurde, die oft zu einer passenden Erscheinung umgezeichnet wurden. Das erweitert den Formenfundus für das Typedesign. Wir befinden uns in einem Zeitalter, wo die Dichte an zugänglichen Schriften unglaublich hoch ist und sich viele Schrifttypen oft nur in Details unterscheiden. Da werden formale Anregungen hilfreich, die sich später entscheidend auf die Wiedererkennbarkeit einer neuen Schrift auswirken.
Michael Mischler Aber eine Frage zurück an Dich, Peter: Du bist mit dem geschriebenen Wort sehr vertraut. Wenn du schreibst oder liest, verlierst du da das eine oder andere Mal einen Gedanken an die verwendete Schrift? Wir als Typedesigner können ja kaum einen Text lesen, ohne uns Gedanken über Zeichenabstände, die Formensprache oder die Lesbarkeit der verwendeten Schrift zu machen – sozusagen als «deformation professionelle».
Peter Glassen Und ob, ich kenne die «deformation professionelle» nur zu gut! Dazu folgende Anekdote, die zeigt, wie stark mein Auge durch meine grafische Berufsausbildung «deformiert» wurde: Vor vielen Jahren verabredete ich mich mit einer Freundin in Berlin. Ich schlug ihr vor, dass wir uns im Restaurant «Bellevue» in der Nähe der Oper treffen sollten. Pünktlich sass ich am verabredeten Ort. Wer nicht kam, war sie. Nach einer Weile sah ich sie draussen suchend auf der Strasse umherlaufen. Ich ging hinaus und fragte, weshalb sie nicht ins «Bellevue» hineinkommt. Und sie antwortete: «Ich kann Dich nicht finden, wenn Du im Restaurant ‹Dressler› sitzt.» Was war geschehen? Ich sass tatsächlich im Restaurant «Dressler» und so hiess es seit Jahren. Der Schriftzug an der Fassade war jedoch in einer Schriftart gesetzt, die der Schrift «Bellevue» ähnlich ist. Ein dekorativer Font, eine Displayschrift, die sich an die Formensprache des «Art déco» anlehnt. Sie passte damit zur gesamten Einrichtung des Restaurants im Stil eines typischen Pariser Bistros der 20er Jahre. Und da ich die Schrift aus der Reklameherstellung gut kannte, war es zu dieser Überlagerung in meinem Kopf gekommen – statt des Restaurantnamens hatte sich mir der Name der Schrift eingeprägt.
Nik Thoenen Über solche Anekdoten können wohl nur Grafiker lachen, oder? Aber hast Du als Semiotiker eine Erklärung für dieses Phänomen?
Peter Glassen Die Semiotik hat eine ganz einfache Erklärung dafür: Wir ordnen Zeichen in unserem Alltag ganz bestimmten Bedeutungen zu. Oft ist mit einem Zeichen nicht nur eine, sondern es sind mehrere Bedeutungen damit verbunden. Der Fachbegriff lautet «Semiose» – eine Verkettung von Bedeutungsassoziationen, die kollektiv oder individuell geprägt sind. Wenn mein Interesse an Typografie grösser ist als das an Namen von Restaurants, dann kann es zu solchen Verschiebungen in der Bedeutungshierarchie kommen. In der Psychologie lässt sich ein ähnliches Phänomen heranziehen. Der Stroop-Effekt macht deutlich, dass erlernte Tätigkeiten nahezu automatisch ablaufen, während ungewohnte Tätigkeiten eine grössere Aufmerksamkeit erfordern. Im Experiment müssen die Teilnehmer die Namen von Farben laut vorlesen. Ist der Name in der jeweiligen Farbe geschrieben – z.B. «rot» in roter Farbe –, fällt das Vorlesen leicht. Haben die Farbworte jedoch eine ganz andere Farbe – z.B. «rot» in grüner Farbe –, fällt es den Probanden schwer, diese schnell auszusprechen. Schrift, Formen und Farben sind in unserem Bewusstsein mit ganz bestimmten Bedeutungen verknüpft. Werden diese erlernten Verknüpfungen durch widersprüchliche Informationen gestört, kommt es zu einer Interferenz. Wir erleben sozusagen, wie unser Gehirn stolpert. In Bezug auf Marken lässt sich dieser Effekt bei den «Reverse Logos» sehr gut nachvollziehen. Von ihnen gibt es zahlreiche Beispiele im Internet. Sehr bekannte Markennamen wurden im Aussehen ihrer Konkurrenten gestaltet. Wir sehen die Logos und nehmen erst auf den zweiten Blick wahr, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. So stark sind sie in unserem Kopf mit ganz bestimmten Bedeutungen besetzt. Doch wieder zurück zum Thema. Schriften haben Charakter. Sie können leise, zurückhaltend, laut, elegant, modern, altmodisch, verspielt usw. sein. Die Schrift spricht zu uns, egal ob als Handschrift oder konstruierter Font. Wenn ihr ein Typeface für einen Kunden gestaltet, wie lasst Ihr Euch vom Charakter der Marke beeinflussen? Wie macht Ihr in einer Wortmarke oder einer Hausschrift Identität sichtbar?